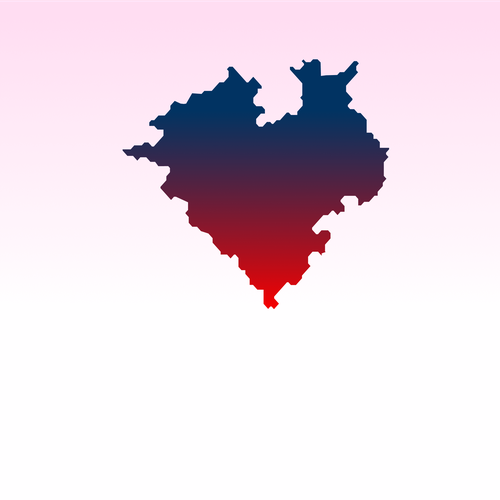1 | Was ist Gedenken?
An wichtigen Gedenktagen werden Kränze niedergelegt und Reden gehalten. Der Historiker Prof. Dr. Malte Thießen leitet das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte und warnt: "Gedenken darf nicht zur Routine werden".
3 | LWL-Klinik Lengerich gedenkt NS-Opfern
Ab Januar 1934 wurden die Insassen der Provinzial Heil- und Pflegeanstalten zwangssterilisiert, deportiert und ermordet. Als Nachfolgeinstitution des Provinzialverbandes, begann der LWL nach einer langen Phase der Verdrängung, erst in den 1970er Jahren mit der Aufbereitung der NS-Verbrechen.
Heute erforscht Dr. Jens Gründler als Historiker am LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte unter anderem die Psychiatriegeschichte im 19. und 20. Jahrhundert.
Parallel zur Forschung entstanden ab den 1980er Jahren in vielen LWL-Kliniken Gedenkinitiativen, die oft von Angehörigen, Pflegekräften, Sozialarbeiter:innen und Ärzt:innen getragen wurden – so zum Beispiel in der LWL-Klinik Lengerich. Dort gibt es bis heute ein vielfältiges und aktives Gedenken, unter anderem in Form eines Gedenkpfads.
Ziel ist es, nicht nur zu erinnern, sondern auch für eine humane Psychiatrie und Kultur der Inklusion einzustehen und aufmerksam jeder Gefährdung der Menschenwürde entgegenzuwirken.
Der Gedenkpfad der LWL-Klinik Lengerich
4 | Gesellschaftliche Verantwortung
„Der LWL nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung an“, sagt der Direktor des LWL, Dr. Georg Lunemann. „Wir erleben seit einigen Jahren die Verharmlosung der Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und der NS-Diktatur. Gerade aber die Mordaktionen in unseren eigenen Einrichtungen sind beispielhaft für einen schmerzlichen Teil unserer Geschichte, dem wir uns stellen müssen – mit Blick auf die NS-Zeit, aber auch mit Blick auf Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit heute.“
„Der Totalitätsanspruch der NS-Diktatur wurde sichtbar in alltäglicher Ausgrenzung und Gewalt gegenüber Juden, gegen politisch Andersdenkende, gegen Menschen mit Behinderungen, gegen psychisch Kranke und gegen all jene, die nicht in die sogenannte 'Volksgemeinschaft' passten“, so Lunemann weiter.
5 | Vielfältiges Gedenken in LWL-Kliniken
Bis 1945 wurden über 3.500 Patientinnen und Patienten der Provinzialheilanstalten zwangssterilisiert, fast 6.000 Patientinnen und Patienten wurden Opfer der NS-„Euthanasie“-Aktionen und umgebracht.
Gedenken findet daher nicht nur in der LWL-Klinik Lengerich statt, sondern an vielen anderen LWL-Kliniken in Westfalen-Lippe.
LWL-Universitätsklinikum Bochum
Verschiedene Aktivitäten seit rund 10 Jahren:
-
Betreuung verschiedener Doktorarbeiten rund um das Thema "Euthanasie" durch den ärztlichen Direktor der Klinik Prof. Georg Juckel; zum Beispiel die Dissertation von Beatrice Rose (2023): "Psychisch kranke Bochumer Bürgerinnen und Bürger im Nationalsozialismus als Opfer von Eingriffen in körperliche Unversehrtheit und Vernichtung" ( -> Infos zur Dissertation)
-
Forschungstätigkeiten und Publikation; Veröffentlichung in "Der Nervenarzt" (2024): "Psychisch kranke Bürgerinnen und Bürger als Opfer von Eingriffen in körperliche Unversehrtheit und Vernichtung in der NS-Zeit am Beispiel einer deutschen Stadt" (-> Infos zur Publikation)
-
Ausstellungen und Vortragsveranstaltungen; zum Beispiel DGPPN-Wanderausstellung (2016), Vorträge bei begleiteten Busfahrten/Schauspielhaus Bochum (5/2025) und vor der Kortum-Gesellschaft Bochum (10/2025)
-
Arbeitskreise in Kooperation mit der Stadt Bochum, Diakonie Ruhr/Bochum, Ruhrgebietsgeschichtsarchiven, Omas gegen Rechts zum Thema "Erinnerungskultur". In den Arbeitskreisen werden Gedenkmöglichkeiten im Raum Bochum besprochen und festgelegt. 2026 ist die zentrale Verlegung einer Stolperschwelle mit Gedenkstelle auf dem Gelände des alten Gesundheitsamtes in Rathaus-Nähe geplant.
LWL-Klinik Dortmund
- Die LWL-Klinik Dortmund wurde 1895 gegründet und hat in ihrer 130-jährigen Geschichte somit die NS-Zeit und den zweiten Weltkrieg erlebt.
- Besonders schrecklich sind in dieser Zeit die Tötungen von Kindern in der Kinderfachabteilung, die von Niedermarsberg nach Dortmund verlegt wurde und dort 1941 die Arbeit aufnahm. 229 Kinder wurden hier getötet, etwa durch die Überdosierung sogenannter Barbiturate. Das sind Psychopharmaka, die sedierend wirken und u.a. wegen zahlreicher Nebenwirkungen heute nicht mehr eingesetzt werden.
- Ebenso wurden Patientinnen und Patienten in andere Anstalten verlegt, wo sie schließlich umgebracht wurden. Eine der ersten von ihnen war Hedwig Rosenberg. Nach ihr wurde das Rosenberg-Haus der LWL-Klinik Dortmund benannt. Damals beherbergte das Haus die Kinderfachabteilung, heute finden dort der LWL-Wohnverbund Dortmund und verschiedene Therapieangebote Platz.
- Die LWL-Klinik Dortmund gedenkt dieser Gräueltaten jährlich am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts am 27. Januar. Dazu gibt es einen Gottesdienst in der Auferstehungskirche auf dem Klinikgelände, den die Auszubildenden der LWL-Pflegeschule Dortmund aktiv mitgestalten. Im Anschluss legt die Betriebsleitung einen Kranz am "Mahnmal gegen das Vergessen der nationalsozialistischen Verbrechen an psychisch Kranken und Behinderten" nieder, das sich ebenso auf dem Klinikgelände befindet. Das Mahnmal wurde 1991 errichtet.
- In der LWL-Klinik Dortmund sind Erklärungen zu den Gräueltaten in der NS-Zeit fester Bestandteil von Führungen, die u.a. von Schulklassen wahrgenommen werden. In einem Verbindungstunnel auf dem Klinikgelände gibt es einen sogenannten "Gang der Geschichte". Dort erzählen mehrere größere Infotafeln die Geschichte der Klinik – auch während der NS-Zeit.
- Weitere Infos gibt es in dem 1995 von der LWL-Klinik Dortmund herausgegebenem Buch "Lebensunwert" des Historikers Uwe Bitzel.
LWL-Klink Gütersloh
Der Klinikfriedhof des heutigen LWL-Klinikums besteht aus drei Bereichen, dem Patient-/innen- und Soldatenfriedhof, die 1910/13 erstmals verzeichnet wurden.
Insgesamt gibt es hier 60 Wahlgrabstätten und 28 Reihengräber. 2014 wurde auf dem Friedhofsgelände eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die im II. Weltkrieg Ermordeten 1.017 Patient-/innen angelegt. Zusätzlich gibt es ein beleuchtetes Namensband in der Kreuzkirche auf dem Klinikgelände. Hier sind die Namen aller ermordeten / deportierten Patient:innen zu sehen.
Die Kreuzkirche ist montags - freitags von 07:00 - 16:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 08:30 - 16:30 Uhr frei zugänglich.
Gottesdienste finden sonntags um 10.00 Uhr statt.
LWL-Klinik Lengerich
Aktives Erinnern in der LWL-Klinik Lengerich:
- Auf Initiative von Beschäftigten wurde 1983 erstmalig eine Gedenktafel im Eingangsbereich der Klinik angebracht. Sie erinnerte daran, dass auch Patient:innen der damaligen Provinzial-Heilanstalt Lengerich Opfer von Krankenmorden geworden sind.
- In den Jahren 2015 bis 2017 wurde nach intensiver Recherche und Vorbereitung der Lengericher Gedenkpfad entwickelt und umgesetzt. Sandsteine mit Zahlen und den Symbolen des blauen Minus und des roten Plus markieren den Weg. 440 Steine erinnern an die einzelnen Opfer. Ihrer wird im Innenhof der Klinik namentlich gedacht. 2023 wurde der Gedenkpfad um eine Skulpturengruppe zum Gedenken an die Opfer von Zwangssterilisationen erweitert.
- Jährlich am 21. September findet eine Veranstaltung zum Aktiven Erinnern statt. Dies ist der Tag, an dem im Jahr 1940 die ersten sieben jüdischen Patienten geholt wurden.
- 2025: Veröffentlichung der Broschüre „Ich bin nicht einverstanden“ über NS-Zwangssterilisationen in der Provinzialheilanstalt Lengerich in den Jahren 1933 bis 1945
- Eine Arbeitsgruppe Gedenkpfad aus aktiven und ehemaligen Mitarbeiter:innen der Klinik, des Wohnverbunds, einer Psychiatrieerfahrenen, Lengericher Bürgern und Interessierten sowie dem Künstler Mandir Tix setzt sich mit der Geschichte auseinander und tauscht sich aus. Sie arbeitet einzelne Aspekte der örtlichen Geschichte in wissenschaftlichen Broschüren auf und entwickelt den Lengericher Gedenkpfad weiter.
LWL-Klinik Marsberg
Auf dem anstaltseigenen Friedhof sind auch Opfer der NS-„Euthanasie“, der „Kinderfachabteilung“ der damaligen Provinzialheilanstalt Marsberg beerdigt. Der Anstaltsfriedhof gehört zu den wenigen Gedenkstätten in Deutschland mit erhaltenen Gräbern.
Das Kollegium der LWL-Schule für die Kinder der Kinder und Jugendpsychiatrie (KJP) und jungen Erwachsenen des Therapiezentrums, führt in ihrer Freizeit Projekttage durch.
Ermordet: Ruth Stukenbrock
Ruth Stukenbrock wird 1927 als jüngstes von sechs Kindern geboren. Mit einem Jahr erleidet sie eine Hirnhautentzündung und bleibt danach in ihrer geistigen Entwicklung zurück. Bis zu ihrem 13. Lebensjahr lebt Ruth mit ihrer Familie auf dem elterlichen Bauernhof. Sie geht nicht zur Schule, kann aber am Hofleben teilnehmen. Im Frühjahr 1941 kommt Ruth in die „Kinderfachabteilung“ der Provinzialheilanstalt Marsberg. Und kehrt nie wieder nach Hause zurück. In der heutigen Kirchstraße in Borgholzhausen erinnert ein Stolperstein an Ruths Schicksal.
Offiziell heißt es in Ruths Krankenakte am 17.8.1942: “Verstorben an Lungentuberkulose (...)”. Die Realität ist: Ruth wurde ermordet. Denn die “Kinderfachabteilung” in Marsberg hat nur einen Zweck: Kinder mit Behinderungen mittels einer Überdosierung des Barbiturats Luminal zu töten. Was von Ruth Stukenbrock geblieben ist, sind die Erinnerungen ihrer Geschwister. Und ein Stolperstein dort, wo sie gelebt hat.
Ruths Schicksal ist nur eines von vielen. Die Nationalsozialisten begingen unter dem Deckmantel der sogenannten "Rassenhygiene" unzählige Verbrechen – darunter die Zwangsterilisation von bis zu 400.000 Menschen und der industrielle Massenmord ganzer Bevölkerungsgruppen. Auch in den ehemaligen Heilanstalten des LWL kam es zu solchen “Medizinverbrechen”. Klinik und LWL sorgen dafür, dass diese Gräueltaten nicht in Vergessenheit geraten. Als Mahnung für die Gegenwart, aber auch als Erinnerung an die Opfer.
LWL-Klinik Münster, Gedenken NS-Psychiatrie-Geschichte
In der LWL-Klinik Münster gibt es folgende Gedenken bzw. Informationen zum Gedenken an die NS-Zeit in der Klinik.
Lukaskirche auf dem Klinikgelände
1984: Im Innenraum der Lukas-Kirche (Klinikgelände) erinnert seit 1984 eine Skulptur und Mahnmal mit dem Titel „Im Feuer verbrannt - Im Rauch bestattet“ der Bildhauerin Margot Stempel-Lebert an die ab dem 21.9.1940 deportierten und ermordeten Patienten:innen der damals als „Marienthal“ bekannten heutigen LWL-Klinik Münster.
2006: Am 1.9.2006 wurden drei Stolpersteine vor der Lukaskirche verlegt. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten „Stolpersteinen“, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.
Schwester Laudeberta
Erinnern möchten die LWL-Klinik auch an den mutigen Einsatz der Ordensschwester Laudeberta. Die Nonne des Ordens der Clemensschwestern warnte Bischof von Galen vor der Deportation von psychiatrischen Patienten:innen. Diese Informationen über die „Euthanasie-Aktion T4“ der Nationalsozialisten veranlassten den Bischof Clemens August Graf von Galen zu seinen bekannten Predigten 1941 in der St.-Lamberti-Kirche in Münster.
Schwester Laudeberta war in leitender Position von 1920 bis 1971 in der LWL-Klinik Münster, tätig.
Um die Erinnerung an Schwester Laudeberta und ihren Heldenmut lebendig zu halten, ist im Sommer 2022 der Uferweg, der Stadt Münster, der sich in der Nähe des Münsterschen Doms befindet, in den Schwester-Laudeberta-Weg umbenannt worden.
Stolpersteinverlegung am 4.10.2025
Am 4.10.2025 wurde an der Wolbecker Str. 103 in Münster ein Stolperstein für Paul Dübe verlegt, der von 1929 bis 1943 in der Provinzial- Heilanstalt Marienthal (heute LWL-Klinik Münster) als Patient behandelt wurde.
Paul Dübe wurde als „Opfer der NS-Rassenhygiene und Euthanasie“ Ende Juni 1943 zum Sammelpunkt „Gertrudenhof“ (Ecke Warendorfer Str. / Kaiser-Wilhelm-Ring) in Münster gebracht, wo seine Schwester Theresia und seine heute noch lebende Nichte Helma ihn persönlich verabschiedeten. Von dort wurde er über die „Zwischenanstalt“ Eichberg in die Tötungsanstalt Hadamar transportiert, wo er am 15.11.1943 im Alter von 38 Jahren ermordet wurde.
Ein Trierer Geschichtsstudent hatte sich mit dem Leben von Paul Dübe beschäftigt und die Verlegung des Stolpersteines angeregt.
LWL-Klinik Warstein
In Warstein findet jedes Jahr am Totensonntag an der Treisekapelle eine Gedenkveranstaltung statt.
In der Treisekapelle gibt es seit 2012 Gedenktafeln mit den Namen der Euthanasieopfer. Jeder Name ist doppelt vorhanden: auf einem abnehmbaren Täfelchen und auf der freiwerdenden Fläche an der Wand. Die abnehmbaren Täfelchen werden an Mitarbeitende, Bürger, Interessierte u.a. verteilt, die damit symbolisch eine Patenschaft übernehmen und die Erinnerung an die Person wachhalten.
Über das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
Das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte ist eine wissenschaftliche Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Es betreibt moderne Regionalgeschichtsforschung mit dem Schwerpunkt auf der Neueren Geschichte und Zeitgeschichte. Die Referentinnen und Referenten erforschen die Sozial-, Politik-, Wirtschafts-, Geschlechter- und Kulturgeschichte Westfalens und darüber hinaus. Mit seinem Fokus auf der Zeit vom 19. Jahrhundert bis heute spürt das Institut der Problemgeschichte der Gegenwart nach.