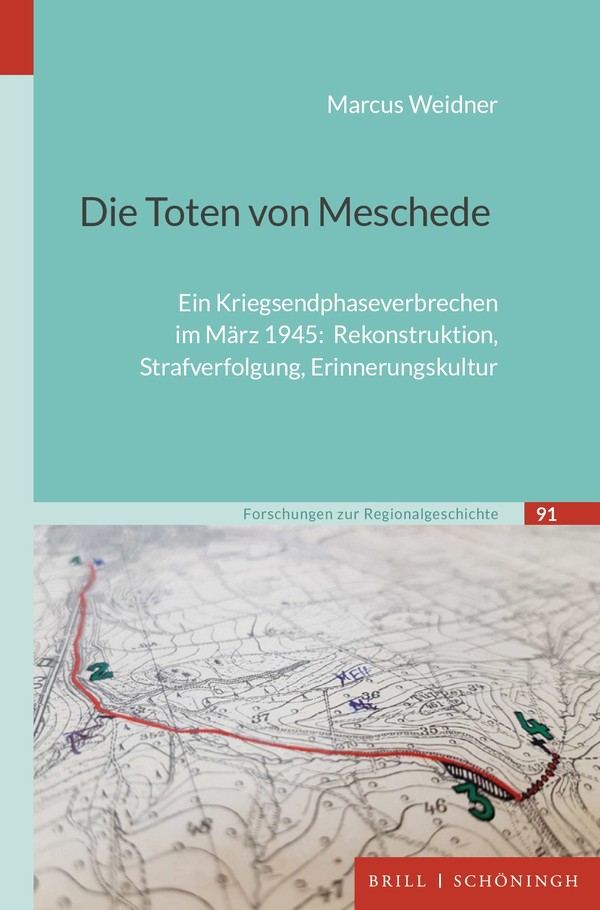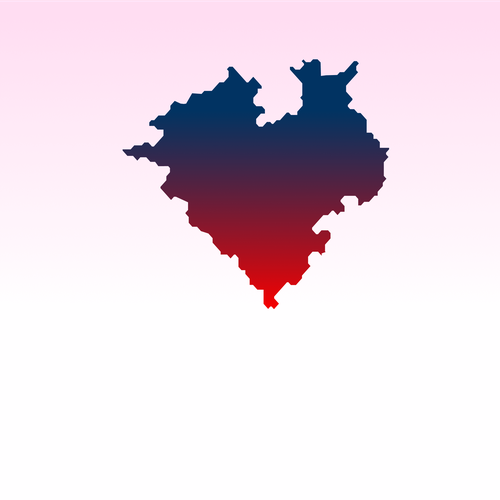1945: Massaker im Sauerland
Und was das mit uns zu tun hat.
Kapitel-Übersicht
- 1 | Tatort: Arnsberger Wald
- 2 | Vera Bessan †
- 3 | Der Befehl
- 4 | Forschungen und Grabungen
- 5 | Drei Tatorte – drei Massaker
- 6 | Ein gestürzter Obelisk
- 7 | Späte Entdeckung, frühe Konfrontation
- 8 | Umgang mit den Tatorten und Tätern
- 9 | Verdrängung statt Aufklärung
- 10 | Verscharrt, verdrängt, vergessen
Was geschah im Arnsberger Wald?
1 | Tatort: Arnsberger Wald
Zwischen dem 20. und 23. März 1945 ereignete sich im Sauerland das schwerwiegendste Kriegsverbrechen der letzten Kriegswochen des Zweiten Weltkriegs – außerhalb von Konzentrationslagern, Gefängnissen und Todesmärschen: In drei Orten im Arnsberger Wald ermordeten Einheiten der „Division zur Vergeltung“ insgesamt 208 Zwangsarbeiter:innen aus Polen und der Sowjetunion.
Der Historiker Dr. Marcus Weidner vom LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte initiierte die archäologischen Grabungen und untersuchte auch die ersten alliierten Ermittlungen, die juristische Ahndung durch deutsche Behörden in den 1950er Jahren und den schwierigen Umgang mit den Taten, ihren Relikten und den Gräbern der Opfer in der Region.
2 | Vera Bessan †
Eine von 208 Ermordeten
Vera Bessan: Gemeinsam mit ihrer Schwester Olga wurde Vera während des Zweiten Weltkriegs aus einem kleinen Ort im Süden des heutigen Belarus zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Die beiden jungen Frauen arbeiteten unter anderem im westfälischen Schwerte. Im April 1944 wurden sie getrennt – Olga kehrte nach Kriegsende in ihre Heimat zurück, während Vera weiterhin in einem Betrieb in Deutschland arbeiten musste.
Am 17. März 1945 – kurz vor Kriegsende – verließ Vera, ob freiwillig oder unter Zwang, ihren Einsatzort. Auf dem Weg nach Osten wurde sie in der Nähe von Suttrop aufgegriffen und ins Quartier der „Division zur Vergeltung“ gebracht. Wenige Tage später, nur wenige Stunden vor ihrem 22. Geburtstag, wurde sie in der Nähe erschossen. Ihre Leiche verscharrten die Täter in einem Massengrab.
Für ihre Mutter und ihre Schwester blieb Veras Schicksal jahrzehntelang ein quälendes Rätsel. Die Familie suchte Zeit ihres Lebens nach ihr – vergeblich. Erst als die Nachricht über die Identifizierung sie erreichte, kamen die Angehörigen noch am selben Abend zusammen. Sie trauerten gemeinsam, tauschten Erinnerungen aus – und schickten das Einzige, was von Vera geblieben war: ein zerknittertes Foto der jungen Frau.
3 | Der Befehl
Hintergrund der Massaker waren Maßnahmen der Polizei- und Parteiführung, mit denen sie in der chaotischen Endphase des Krieges versuchten, die Bewegungen ausländischer Zwangsarbeiter:innen, die dem Kampfgeschehen entfliehen wollten, zu kontrollieren. Auf deutscher Seite herrschte die Angst vor Aufständen, Plünderungen und Sabotageakten durch die zur Arbeit gezwungenen Menschen – auch wenn es in der Region keine bestätigten Plünderungen gegeben hatte.
Als angebliche Präventivmaßnahme erließ NSDAP-Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Albert Hoffmann den sogenannten „Harkortbergbefehl“. Darin forderte er, Personen, die sich außerhalb der Flüchtlingsrouten bewegten oder plünderten, ohne Verfahren zu erschießen. Der SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Hans Kammler griff diesen Befehl offenbar auf und befahl im Rahmen sogenannter Amtshilfe die „Dezimierung“ der Zwangsarbeiter:innen.
Die Massaker wurden bereits kurz nach Kriegsende in der Region im April 1945 bekannt. US-Truppen zwangen im Rahmen einer „Sühnemaßnahme“ die Bevölkerung von Warstein, Belecke, Suttrop und Kallenhardt, die exhumierten Leichen in Langenbachtal und Suttrop anzusehen. Die Opfer von Eversberg wurden erst 1947 geborgen. Trotz dieser frühen öffentlichen Konfrontation fand das Thema in der historischen Forschung lange kaum Beachtung.
4 | Forschungen und Grabungen
Da die Exekutions- und Verscharrungsorte in der Nachkriegszeit nie archäologisch untersucht worden waren, begannen 2018 – aufbauend auf den Forschungen von Weidner – mehrere Grabungen der LWL-Archäologie für Westfalen. Dabei wurden hunderte Fundstücke entdeckt, die sowohl mit den Tätern als auch mit den Opfern in Verbindung stehen und zum besseren Verständnis des Tathergangs beitrugen.
Erst in den vergangenen Jahren wurde das Verbrechen umfassend durch den Historiker Dr. Marcus Weidner vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) erforscht. Zufällig auf den Fall gestoßen, rekonstruierte er die Geschehnisse, analysierte die juristische Aufarbeitung in den 1950er-Jahren sowie die Entwicklung der Erinnerungskultur bis in die 1990er-Jahre.
5 | Drei Tatorte – drei Massaker
Langenbachtal
Die umfangreichsten archäologischen Funde stammen vom Ort der ersten Mordaktion: Im Langenbachtal bei Warstein führten Mitglieder des Mordkommandos 71 Zwangsarbeiter:innen, darunter 60 Frauen, unter einem Vorwand in den Wald. Dort wurden sie erschossen. Zuvor mussten sie am Straßenrand ihre persönlichen Gegenstände ablegen – in dem Glauben, diese nach einem angeblichen Arbeitseinsatz wieder abholen und anschließend in eine neue Unterkunft ziehen zu können.

Viel Besitz hatten die Opfer nicht bei sich. Die meisten besaßen nur die Kleidung, die sie am Leib trugen, und wenige Gegenstände, die ihnen im harten Alltag das Überleben erleichtern sollten. Reste dieser persönlichen Besitztümer, die von den Erschießungskommandos nicht mitgenommen wurden, entdeckten die LWL-Archäolog:innen in der Erde verscharrt. Darunter finden sich ein Gebets- und ein Wörterbuch auf Polnisch, Schuhe und Teile der Kleidung wie bunte Knöpfe und Perlen zum Aufnähen. Das Fundgut enthält aber auch Gebrauchsgegenstände wie Geschirr und Besteck.

Schmuck, Perlen, Schuh und Schüsseln aus dem Besitz der Opfer
Nach der Ermordung verteilten die Täter einen Teil dieser Habseligkeiten an bedürftige Anwohner:innen in der Gegend. Etwa 1.000 Reichsmark, die man bei den Opfern fand, wurden gestohlen und der Kasse der Division zugeführt.
Meschede-Eversberg
Am folgenden Tag, dem 21. März 1945, wurden in der Nähe von Meschede-Eversberg rund 80 Zwangsarbeiter aus Polen und der Sowjetunion erschossen. Nach Aussagen der Täter sei dies ein „Ausgleich“ gewesen – da im Langenbachtal angeblich „zu viele Frauen“ getötet worden seien. Die Opfer wurden in einer eigens ausgehobenen Grube erschossen. Dieses Vorgehen erinnert in seiner Planung und Grausamkeit an die systematischen Massenmorde der Shoah.

Auch in Meschede-Eversberg blieben zirka 50 Objekte liegen, die vom Alltag der Zwangsarbeiter zeugen. Angesichts deren katastrophalen Lebensbedingungen wirken manche Funde überraschend wie Teile einer Mundharmonika. Ein Brillenetui und ein Kamm stehen als zusammengehörige Habe schlaglichtartig für den kleinsten Besitz der Zwangsarbeiter.
Warstein-Suttrop
Die dritte Mordaktion fand am 22. März in Warstein-Suttrop statt.

Dort töteten die Täter 57 Zwangsarbeiter:innen in einem eigens angelegten Zickzack-Graben. Unter den Opfern war auch ein Säugling. Sein Tod wurde besonders brutal beschrieben: Der Kopf des Kindes soll gegen einen Baum geschlagen worden sein.
Die archäologische Grabung des LWL konnte den Tatort anhand vieler Kleinfunde genau identifizieren. Darunter sind vor allem sowjetische Münzen. Auch ein Löffel verweist wegen seiner Prägung auf die Herkunft der Ermordeten aus der Sowjetunion. Männer der SS und Wehrmacht hatten diese für sie nutzlosen Objekte nicht eingesammelt.
6 | Ein gestürzter Obelisk
Ein besonders bedeutender Fund war ein über drei Meter hoher sowjetischer Gedenkobelisk. Er war 1945 auf Befehl der Alliierten an der Grabstätte im Langenbachtal (ein zweiter in Suttrop) errichtet worden – als Erinnerung an die ermordeten Zwangsarbeiter:innen.
Doch 1964, nach der offiziellen Auflösung des Friedhofs, wurde der Obelisk unter dem Vorwand, man müsse darunter nach Gräbern suchen, entfernt und in ein leeres Grab gestürzt. Das Wort „Mord“ war schon vorher aus der Inschrift herausgemeißelt worden. Weidner: „Ziel war es offenbar, alle sichtbaren Spuren des Verbrechens aus dem Stadtbild zu tilgen. In Warstein sollte nichts mehr an die Morde erinnern.“
7 | Späte Entdeckung, frühe Konfrontation
Die Morde auf der sogenannten „Eversberger Kuhweide“ blieben lange im Verborgenen. Erst Ende 1946 erhielt die britische Militärverwaltung einen anonymen Hinweis auf das Verbrechen. Daraufhin sorgten die Alliierten dafür, dass die sterblichen Überreste der Opfer im März 1947 exhumiert und auf dem Waldfriedhof Fulmecke in Meschede beigesetzt wurden.
Anders verhielt es sich bei den Massakern in Warstein und Suttrop: Die US-Truppen wurden bereits wenige Wochen nach der Befreiung auf die Leichen aufmerksam. Hinweise der örtlichen Bürgerwehr führten im April 1945 zur Entdeckung der Massengräber. Die amerikanische Besatzung ordnete die sofortige Exhumierung an – durchgeführt von ehemaligen NSDAP-Funktionären.
Als Teil einer gezielten „Sühnemaßnahme“ mussten alle Bewohner:innen, einschließlich Kinder, an den Leichen vorbeiziehen. Anschließend wurden die Opfer von den früheren Parteimitgliedern in unmittelbarer Nähe der Erschießungsorte auf neu angelegten Friedhöfen beigesetzt. Die gesamte Aktion wurde von den US-Amerikanern umfassend fotografisch und filmisch dokumentiert, um die Verbrechen für die Nachwelt zu belegen.
8 | Umgang mit den Tatorten und Tätern
Ein besonderes Beispiel für die Schwierigkeiten bei der Gedenkkultur zeigt sich am Tatort in Suttrop. Der dortige adelige Grundbesitzer verweigerte zunächst die Freigabe seines Grundstücks für einen Friedhof. Erst nach einer Nacht in US-Haft erklärte er sich einverstanden. Dennoch wurde das Areal später nicht als Gedenkstätte geschützt: Auf den Gräbern wuchsen Fichten, ohne dass eine Aufsichtsbehörde einschritt. Als 1964 die Umbettung der Leichen erfolgte, konnten sieben von ihnen nicht mehr gefunden werden. Archäologische Untersuchungen legen nahe, dass sie heute unter einem später errichteten Straßendamm begraben liegen.
Bereits 1945 gelang es US-Kriegsverbrecherermittlern, einige der Täter namentlich zu identifizieren. Trotz Aufnahme in die Fahndungslisten blieb eine strafrechtliche Aufarbeitung jedoch weitgehend aus.
9 | Verdrängung statt Aufklärung
Lange Zeit zeigten die deutschen Behörden kein Interesse daran, das Massaker im Arnsberger Wald strafrechtlich aufzuarbeiten oder die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Erst eine anonyme Anzeige – die der Historiker Dr. Marcus Weidner später einem unzufriedenen Bürger aus Warstein zuordnen konnte – brachte 1956 Bewegung in den Fall. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg nahm daraufhin Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Täter auf.
Der erste Prozess vor dem Landgericht Arnsberg in den Jahren 1957/58 endete mit einem Urteil, das breite Empörung auslöste. Die Strafen wurden als skandalös milde empfunden. Das Gericht erkannte weder die rassistische Auswahl der Opfer noch die grausame Tötungspraxis oder die systematische Täuschung als Mordmerkmale an.
Vielmehr wurde die Tat – entgegen der historischen Faktenlage – nicht als Teil der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik gewertet, sondern als Folge allgemeiner Kriegsumstände eingeordnet. Obgleich der damalige Warsteiner Bürgermeister Gierig die Zwangsarbeiter:innen im Wissen, dass diese erschossen werden sollten, aus der städtischen Obhut herausgegeben hatte, wurde er nicht belangt.
Diese Einschätzung stand im Kontext des beginnenden Kalten Kriegs: Die Opfer stammten aus Osteuropa, sie hatten zudem keine Verbindungen zur Ortsbevölkerung und viele Behörden sowie Teile der Gesellschaft zeigten eine ausgeprägte „Schlussstrich“-Mentalität. Weidner: „Eine umfassende juristische Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen war zu diesem Zeitpunkt politisch und gesellschaftlich vielfach nicht gewollt.“

Der öffentliche Protest über das Arnsberger Urteil reichte bis in den Deutschen Bundestag. Im Revisionsverfahren vor dem Landgericht Hagen im Jahr 1959 wurde das ursprüngliche Urteil schließlich aufgehoben. Der Haupttäter Wolfgang Wetzling wurde wegen Mordes verurteilt und verbrachte seine Haftzeit bis 1974 im Gefängnis.
10 | Verscharrt, verdrängt, vergessen
Ihre endgültige Ruhestätte fanden die ermordeten Zwangsarbeiter:innen aus Warstein und Suttrop im Jahr 1964 auf dem Waldfriedhof Fulmecke in Meschede. Im Zuge der Umbettung konnten einige der Opfer anhand mitgeführter Papiere identifiziert werden. Dennoch wurden sie – entgegen der gesetzlichen Vorgaben – von den deutschen Behörden anonym beigesetzt. Damit wurde den Angehörigen nicht nur die Möglichkeit genommen, vom Schicksal ihrer Verwandten zu erfahren, sondern auch, die so ja nicht namentlich gekennzeichneten Gräber jemals aufzusuchen. Zusätzlich erschwerten irreführende Inschriften auf den Gedenksteinen das Verständnis des Geschehens: Der Zusammenhang mit der Mordtat wie auch das bekannte Morddatum wurden verschleiert.
Obwohl Tausende Menschen im Rahmen der „Sühne-Aktion“ 1945 von der Tat erfahren hatten und der Prozess in den 1950er Jahren öffentliches Aufsehen erregte, entwickelte sich kein kollektives Gedenken. Die Tat wurde als Makel des Orts empfunden. Viele Einwohner:innen versuchten, die traumatischen Bilder zu vergessen. Eine „Schlussstrichmentalität“ prägte das Klima der Nachkriegszeit. Die deutsche Mehrheitsbevölkerung sah sich als Opfer eines brutalen Regimes.
Erst ab den 1980er Jahren – mit einem gesellschaftlichen Wandel und dem wachsenden Interesse an der lokalen NS-Vergangenheit – begannen engagierte Bürger:innen in Suttrop (1989) und Warstein (1993) mit der Schaffung von Gedenkzeichen.

Was hat das mit uns zu tun?
Dr. Marcus Weidner ist Historiker und Wissenschaftliche Referent am LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte
Warum machen Menschen sowas?
Prof. Dr. Malte Thießen, Leiter des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte, ordnet die Geschehnisse ein.
„Wir wollen die Erinnerung an Taten wie die im Arnsberger Wald wachhalten. Denn sie kamen nicht über die Region wie ein Unwetter. Diese Taten hatten einen Hintergrund. Sie hatten gesellschaftliche Voraussetzungen.“
Dr. Georg Lunemann, der Direktor des LWL
Die Toten von Meschede
Die Ermordung von 208 osteuropäischen Zwangsarbeiter:innen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs und die archäologische Untersuchung der Tatorte
Dr. Marcus Weidner hat in seinem Buch über "Die Toten von Meschede" die dreitägigen Massaker im Sauerland rekonstruiert.
Das Buch ist in der Reihe Forschungen zur Regionalgeschichte (Band 91) erschienen.
Der Historiker und Wissenschaftliche Referent am LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte hatte die archäologischen Grabungen initiiert und untersucht in der Publikation auch die ersten alliierten Ermittlungen, die juristische Ahndung durch deutsche Behörden in den 1950er Jahren und den schwierigen Umgang mit den Taten, ihren Relikten und den Gräbern der Opfer in der Region.
Zum Autor
Nach Studium und Promotion 1998 arbeitete Marcus Weidner unter anderem am LWL-Archivamt für Westfalen, am Historischen Museum in Bremerhaven und am LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster.
Im Jahr 2002 kam der Historiker an das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte. Hier beschäftigt sich Weidner seitdem unter anderem mit Internet-Projekten (u.a. Internet-Portal "Westfälische Geschichte"), Erinnerungskultur, Adelsgeschichte, NS-Geschichte und Kriegsverbrechen, Digital Humanities und mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in den Geschichtswissenschaften. Zurzeit baut Weidner ein Internet-Portal zur Geschichte des Nationalsozialismus, der Verfolgung und des Zweiten Weltkriegs ("NS-Topografie") auf.
Weidner war Lehrbeauftragter an den Universitäten Paderborn und Bochum. Seit 2009 ist er Mitglied der Historischen Kommission für Westfalen.
Archivmaterial, historische Aufnahmen und Pressedownloads
Fotos, Filme, Rundfunkmitschnitte und mehr
- Warstein im Mai 1945 − US-Filmmaterial über das Kriegsendphaseverbrechen im Warsteiner Langenbachtal
- Suttrop im Mai 1945 − US-Filmmaterial über das Kriegsendphaseverbrechen bei Suttrop
- Der Arnsberger Prozess 1957/58 − Film- und Audiomaterial des Westdeutschen Rundfunks (WDR)
- LWL-Film über die Ausgrabungen im Langenbachtal
- LWL-Film: Ermordet, verscharrt, verdrängt − archäologische Forschungen zu Weltkriegsverbrechen in Warstein
- ARD Geschichte im Ersten: Das Massaker im Arnsberger Wald
- Pressedownloads (Bitte Hinweis zu Nutzungsrechten beachten)






![Obelisk mit Aufschrift "Hier ruhen russische Bürger bestialisch ermordet in faschistischer Gefangenschaft. Ewiger Ruhm den gefallenen Helden des [...] Obelisk mit Aufschrift "Hier ruhen russische Bürger bestialisch ermordet in faschistischer Gefangenschaft. Ewiger Ruhm den gefallenen Helden des [...]](/media/filer_public/a2/bb/a2bbd63b-ac94-4109-adb2-7a94a65cba14/obelisk_auf_schwarz_neu.png)